Personen und Kontakte
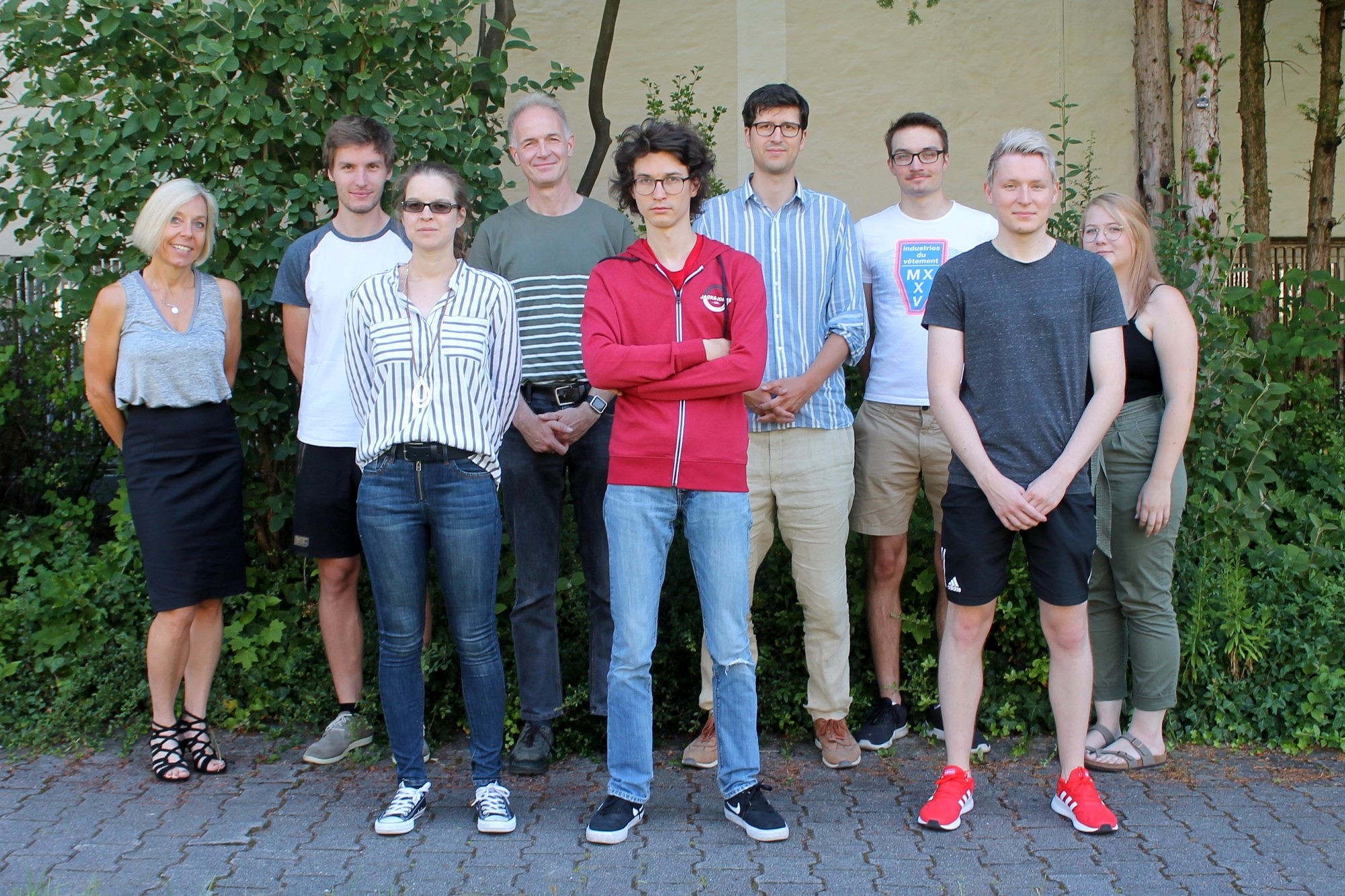
Das Team der Professur für Alte Geschichte (2020)
Professoren
Prof. Dr. Boris Dreyer
Dozent
Kochstr. 4, Postfach 8
91054 Erlangen
Kochstr. 4, Postfach 8
91054 Erlangen
- Telefon: +49 9131 85-25768
- E-Mail: boris.dreyer@fau.de
- Webseite: https://www.geschichte.phil.fau.de/person/boris-dreyer/
Sekretariat

Urban, Isabelle
isabelle.urban@fau.de
Tel. 09131 8525764
Öffnungszeiten:
Mo 14-16 Uhr
Di 14-17 Uhr
Do 14-17 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/Doktoranden
Christina Sponsel-Schaffner, M.A.
Bismarckstraße 6 (Büro)
91054 Erlangen
91054 Erlangen
- Telefon: +49 9131 85-25762
- E-Mail: christina.erika.sponsel@fau.de
Hilfskräfte und Tutoren
Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte
Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte
Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte
Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte
Studentische Hilfskraft und Tutor an der Professur für Alte Geschichte
Studentische Hilfskraft an der Professur für Alte Geschichte
Tutor an der Professur für Alte Geschichte
Tutor an der Professur für Alte Geschichte



